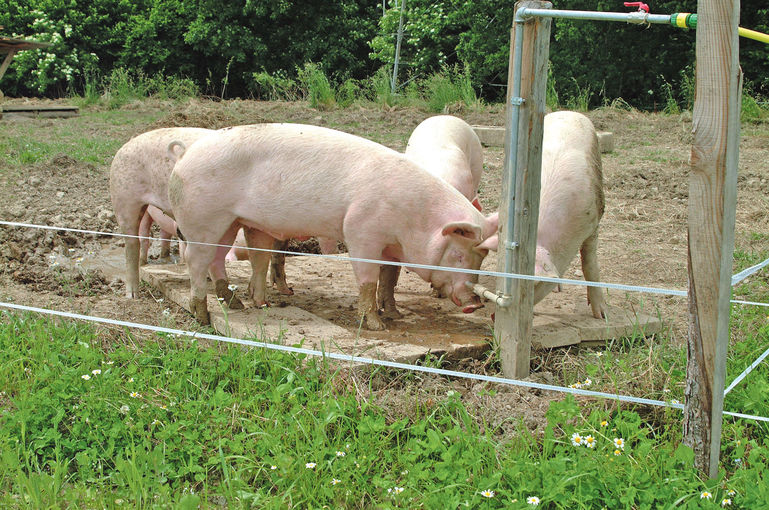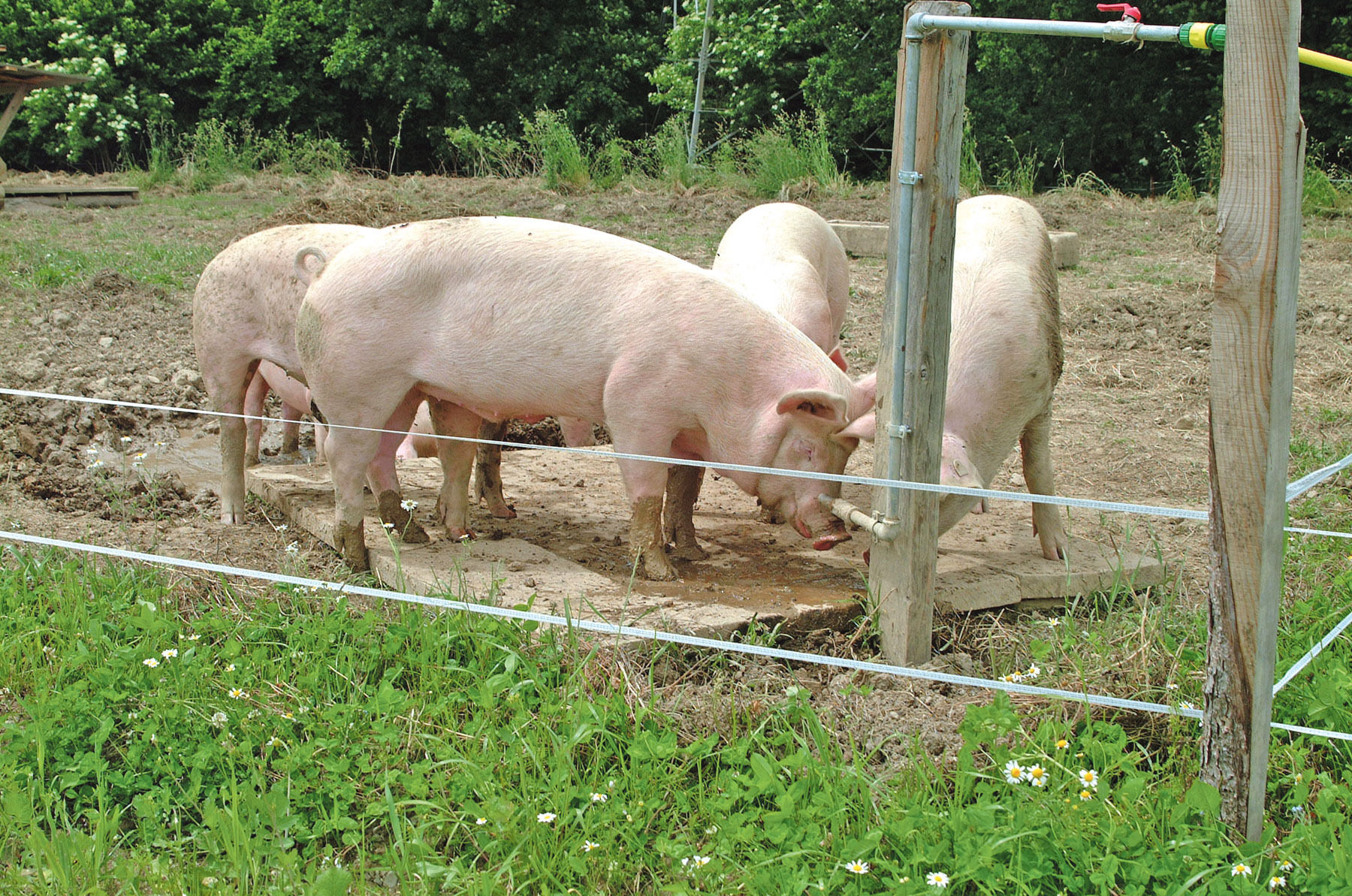Weniger Tiere am Hektar, dafür höhere Erlöse?
Die EU-Kommission hat durchrechnen lassen, was die Auswirkungen eines Deckels für die Tierbesatzdichte in der Europäischen Union wären. Modelliert wurde mit Viehbesatzobergrenzen von zwei Vieheinheiten je Hektar beziehungsweise 1,4 Vieheinheiten je Hektar. Zum Vergleich: In der Weser-Ems-Region lag die Besatzdichte 2018 bei 3,22 Vieheinheiten.
Als Folge der Begrenzung wären niedrigere Bestände laut den Modellrechnungen besonders für Geflügel und Schweine, weniger dagegen für Rinder zu erwarten. Das lässt sich den Autoren zufolge durch eine Kombination aus der stärkeren Konzentration der Schweinefleischproduktion und vergleichsweise höheren Gewinnmargen von Milchkühen erklären. Auswirkungen werden auch auf die Pflanzenproduktion erwartet, und zwar durch die geringere Nachfrage nach Futtermitteln. Während entsprechende Kulturen eingeschränkt werden dürften, soll die Produktion von Leguminosen ausgeweitet werden. Dadurch würde den Wissenschaftlern zufolge auch der Einsatz von mineralischem Stickstoffdünger tendenziell abnehmen, während die Nachfrage nach Phosphor und Kalium aufgrund des knapperen Angebots an Wirtschaftsdünger steigen würde.
Für den Konsum in der EU berechnen die Wissenschaftler eine teilweise Substitution tierischer durch pflanzliche Lebensmittel. Gleichzeitig sollen jedoch die Gesamtausgaben für tierische Erzeugnisse steigen, insbesondere für Fleisch und Eier, etwas weniger für Milchprodukte. Ein Anstieg der Importe von Rindfleisch wird aufgrund der Beschränkungen durch das europäische Zollsystem nicht erwartet. Den Import großer Mengen an Schweinefleisch sehen die Wissenschafter durch einen Mangel an Produzenten außerhalb der EU ebenfalls begrenzt.
Angetrieben durch höhere Erzeugerpreise steigt in allen von den Autoren berechneten Szenarien das gesamte landwirtschaftliche Einkommen in der EU. Allerdings sollen die Unterschiede zwischen den Sektoren und Regionen erheblich ausfallen. Während das Einkommen von Tierhaltern voraussichtlich steigen würde, da der Anstieg der Erzeugerpreise die Auswirkungen der geringeren Produktionsmengen mehr als ausgleichen könnte, werden sinkende Einkommen im Ackerbau erwartet, da die höhere Nachfrage nach bestimmten Lebensmitteln den Rückgang der Futternachfrage nicht vollständig kompensieren würde.
Als Folge der Begrenzung wären niedrigere Bestände laut den Modellrechnungen besonders für Geflügel und Schweine, weniger dagegen für Rinder zu erwarten. Das lässt sich den Autoren zufolge durch eine Kombination aus der stärkeren Konzentration der Schweinefleischproduktion und vergleichsweise höheren Gewinnmargen von Milchkühen erklären. Auswirkungen werden auch auf die Pflanzenproduktion erwartet, und zwar durch die geringere Nachfrage nach Futtermitteln. Während entsprechende Kulturen eingeschränkt werden dürften, soll die Produktion von Leguminosen ausgeweitet werden. Dadurch würde den Wissenschaftlern zufolge auch der Einsatz von mineralischem Stickstoffdünger tendenziell abnehmen, während die Nachfrage nach Phosphor und Kalium aufgrund des knapperen Angebots an Wirtschaftsdünger steigen würde.
Für den Konsum in der EU berechnen die Wissenschaftler eine teilweise Substitution tierischer durch pflanzliche Lebensmittel. Gleichzeitig sollen jedoch die Gesamtausgaben für tierische Erzeugnisse steigen, insbesondere für Fleisch und Eier, etwas weniger für Milchprodukte. Ein Anstieg der Importe von Rindfleisch wird aufgrund der Beschränkungen durch das europäische Zollsystem nicht erwartet. Den Import großer Mengen an Schweinefleisch sehen die Wissenschafter durch einen Mangel an Produzenten außerhalb der EU ebenfalls begrenzt.
Angetrieben durch höhere Erzeugerpreise steigt in allen von den Autoren berechneten Szenarien das gesamte landwirtschaftliche Einkommen in der EU. Allerdings sollen die Unterschiede zwischen den Sektoren und Regionen erheblich ausfallen. Während das Einkommen von Tierhaltern voraussichtlich steigen würde, da der Anstieg der Erzeugerpreise die Auswirkungen der geringeren Produktionsmengen mehr als ausgleichen könnte, werden sinkende Einkommen im Ackerbau erwartet, da die höhere Nachfrage nach bestimmten Lebensmitteln den Rückgang der Futternachfrage nicht vollständig kompensieren würde.